"And
you want to travel with her, and you want to travel blind / and you
know she will trust you, for you've touched her perfect body with your
mind." Zeilen, die einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Zeilen,
die begreiflich machen, wozu Sprache fähig sein kann. Geraunt von einem
etwas bieder aussehenden Mann, stets vorzüglich gewandet. Ein Künstler,
ein Dichter ist er, dieser Leonard Cohen. Ein talentierter Sänger
weniger, wobei das, was er Ende der Sechziger stimmlich zu fabrizieren
in der Lage war, im Vergleich zu seinem heutigen Geröchel beinahe wie
Operngesang wirkt.
Aber darum geht es auch nicht. Die
Stimme passt perfekt zur Musik. Rastlose Zupfmuster, spukige Streicher,
schräge Bläserakzente, dazu der monoton-rezitative Singsang Cohens. Mit
minimalen Mitteln erzeugt er eine ungemein intime Atmosphäre. Im Zentrum
stehen die Texte, die Geschichten, die er erzählt. Strophen, die man in
Gänze wiedergeben muss, um ihre Schönheit zu begreifen:
"When I left they were sleeping,
I hope you run into them soon.
Don't turn on the light
You can read their address by the moon;
And you won't make me jealous
If I hear that they sweeten your night
We weren't lovers like that
And besides it would still be all right." (aus "Sisters of mercy")
Die
Bilder, die Cohen heraufbeschwört, entstehen aus den Zwischentönen, den
Wechselwirkungen angedeuteter Gefühlslagen. Und obwohl die Sprache
stets vage bleibt, erzeugt jedes Lied eine ganz bestimmte Emotion. So
ist beispielsweise "So long, Marianne" ein Song, der selbst Ertrinkenden
ein Lächeln aufs Gesicht zaubern dürfte. Und "Teachers" ist in bestem
Sinne verzweifelt.
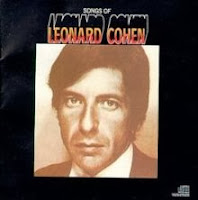
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen