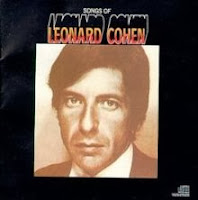Ich bin mit dem Radio aufgewachsen. In der Küche, bei den Hausaufgaben, während dem Spielen - das Radio lief eigentlich immer nebenher. Was mir aus heutiger Perspektive kaum noch nachvollziehbar scheint, war damals vollkommen normal. Vielleicht, weil ich die meiste Zeit ohnehin nicht richtig hingehört habe, vielleicht aber auch, weil früher alles besser war. (außer Tiernahrung)
Bevor ich anfing, mich intensiver mit Musik zu beschäftigen, war sie nicht viel mehr als Alltagsbegleitung und Freizeitberieselung. Und womit berieselt es sich am besten? Natürlich mit Formatradiosendern. (Zudem hätte ich als Zehnjähriger mit dem Radiofeuilleton auf Bayern 2 wohl sowieso wenig anfangen können.)
Aber darum soll es hier und heute nicht gehen. Ich möchte über einen Mann sprechen, der Generationen von Radiohören begleitet hat, und auch heutzutage noch Stammgast in den Playlisten ist. Die Rede ist selbstverständlich vom King of Muzak höchstselbst. Einem sicherlich sehr sympathischen Herren, der völlig zu Unrecht von allen Seiten Hiebe einstecken musste, obwohl er doch die perfekte Bügelmusik komponiert hatte.
Ihr ahnt sicher bereits, wer gemeint ist: Niemand anderer als Philip David Charles Collins.
Es gilt, zunächst eine Sache klarzustellen: Im Gegensatz zu manch anderen musikalischen Kapitalverbrechern ist Phil Collins' Musik ziemlich okay. Bieder vielleicht, nervig wohl auch, aber bei weitem nicht so zornauslösend wie beispielsweise die ganze Armada deutschprachigen Befindlichkeitsgedudels a la Ich & Ich, Rosenstolz oder Silbermond.
Phil Collins tut niemandem weh. Und genau darin steckt die Perfidie.
Im Nullsummenspiel der glattgebügelten Konsensmucke war Collins lange Zeit so etwas wie der Hüter des heiligen Grals. Seine hier nicht weiter zu diskutierende Vergangenheit als Drummer von Genesis hinter sich lassend, wandte er sich Anfang der Achtziger mehr und mehr der Popmusik zu, bis ihm schließlich "In the air tonight" zum Durchbruch als Solokünstler verhelfen sollte.
"In the air tonight" ist ein auf mehreren Ebenen sehr gelungenes Stück. Die zurückhaltend wabernden Synthies erzeugen im Wechselspiel mit Text und Gesang eine gewisse Spannung, die sich schlussendlich in einem äußerst markanten Schlagzeugeinstieg entlädt. Collins' Stimme umweht ein kurzer, leicht klirrender Halleffekt, wodurch sie in der Leere zu schweben scheint. Der Song ist ein Paradebeispiel für Collins' zweifellos vorhandenes musikalisches Talent; er ist einprägsam, perfekt produziert und in Klangbild und Melodieführung einzigartig.
Auf dem Phil herumzuhacken war lange Zeit so etwas wie ein Volkssport unter Musikbeschreibern und selbsternannten Geschmacksträgern. Gewiss gibt es zahlreiche gute Grunde, weswegen Phil Collins' Oeuvre im Vorzimmer zum Fegefeuer anzusiedeln ist, aber ganz so einfach darf man es sich nicht machen.
Collins hatte nämlich das verstanden, was ich im Folgenden "die Formel" nennen werde.
Seitdem die Musikindustrie existiert, beißen sich Komponisten, Manager und Zahlenverdreher an der Formel die Zähne aus. Das fiese an der Formel ist, dass sie permanenten Permutationen unterliegt. Was sich gestern noch millionenfach verkauft hatte, verstaubt heute unangeklickt auf iTunes. Allein die Zahl der bis dato unter den Tisch gefallenen One-hit-wonder spricht Bände. Nicht das Was, sondern das Wie entscheidet.
Bei vielen sogenannten Superstars kann man ziemlich schnell nachvollziehen, weswegen sie einfach nicht kaputtzukriegen sind. Manche erfinden sich fortwährend neu (bzw. werden von ihrem Management neu erfunden), andere verzichten im Laufe ihrer Karriere sukzessive auf Kleidungsstücke, um vom Mangel an künstlerischer Innovation abzulenken. Wieder andere heißen Lemmy Kilmister.
Phil Collins hat seine Klamotten anbehalten. Und großartig innovativ oder trinkfreudig war der Mann mit dem schütteren Haar nie gewesen. Er konnte ja nicht einmal tanzen.
Das Geheimnis seiner Popularität ist gerade in dieser Abwesenheit von distinktiven Merkmalen zu suchen. Oft spricht man ja von "Projektionsflächen", wenn man "langweilig" meint. Collins ist ein Langweiler, und zwar ein meisterhafter.
Selbst wenn ein Collins-Song mal richtig flott daherkommt, klingt er nicht wirklich mitreißend. Man denke an "Jesus he knows me", "Sussudio" oder "Can't hurry love". Der Stock sitzt zu tief und fest, als dass man ihn zum Tanzen aus dem Arsch nehmen könnte.
Womit wir beim Kern der Sache angelangt wären: Phil Collins ist genauso wie seine Hörer, er ist genauso wie die meisten Menschen - auch wenn diese nicht müde werden, abweichender Meinung zu sein. Wenn Collins von Liebe und anderen Gefühlsvorstellungen singt, geht er stets den Weg des geringsten Widerstandes. Während jedoch z.B. im Schlager derlei Botschaften auf plumpe Weise mit dorfdiscotauglichen Konnotationen unterfüttert werden, wahrt Collins immer ein gewisses Maß an Würde und Distanz - sowohl zu seinem Publikum als auch zu seiner eigenen Person.
Der Mensch Phil Collins tritt hinter die Songs zurück, was ihm ganz ungeachtet der Frage nach der Qualität seiner Stücke als Verdienst angerechnet werden muss. Ob er nun Tarzan besingt, oder Toleranz und Mitgefühl predigt, ist egal, ja selbst, wenn er alles ernst meinen sollte, macht das keinen großen Unterschied.
Nun sind dies keine taufrischen Erkenntnisse. Der Hahn, der einst nach Phil Collins gekräht hatte, hat längst den Heuhaufen gewechselt. "Lebbe geht weiter" würde ein längst vergessener Bundesligatrainer sagen.
Für mich ist Philip Collins eine Kindheitserinnerung. Das war der Typ, der immer zwischen den Boggnsacks und den Feuchtgrubers auf Antenne Bayern lief. Der Mann, dessen Alben nur in Plattensammlungen auftauchen, wenn diese auch CDs von Tina Turner, Bon Jovi und Foreigner enthalten. Ein Musiker, der als Geschmacksgrenze fungiert.